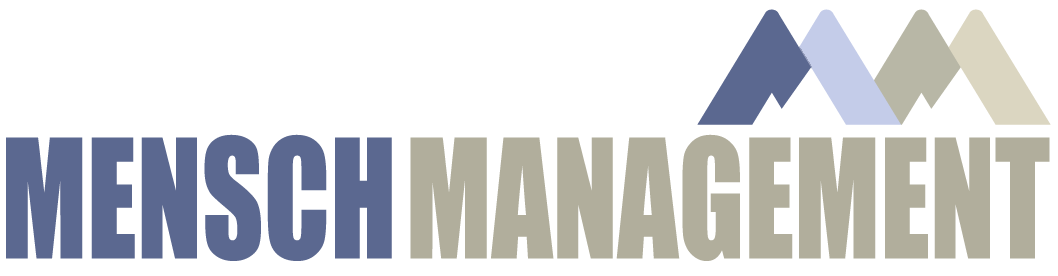Wenn wir in unseren Seminaren zu emotionaler Intelligenz nach Emotionen fragen, die Menschen im Alltag stärker spüren möchten, wird neben Zufriedenheit und Sicherheit fast immer auch Gelassenheit genannt.
Gerade in einer Arbeitswelt mit hoher Geschwindigkeit und ständiger Veränderung ist Gelassenheit ein entscheidender Faktor für Resilienz. Doch wie lässt sich dieses Gefühl bewusst fördern?
Wissenschaftliche Perspektive: Warum Gelassenheit wirkt
Gelassenheit bedeutet nicht Gleichgültigkeit – sondern die Fähigkeit, ruhig zu bleiben, auch wenn die Umstände herausfordernd sind.
Studien zeigen:
- Menschen, die regelmäßig Achtsamkeit oder Meditation praktizieren, reagieren weniger impulsiv auf Stress (z. B. Davidson, 2003).
- Gelassenheit hängt eng mit emotionaler Selbstregulation zusammen – wer seine Gefühle wahrnimmt, kann besser entscheiden, wie er darauf reagieren möchte.
- Auf lange Sicht stärkt Gelassenheit nicht nur die psychische Gesundheit, sondern auch die kognitive Leistungsfähigkeit.
Gelassenheit individuell stärken
Auf persönlicher Ebene hilft Gelassenheit, den eigenen Handlungsspielraum zurückzugewinnen:
- Atemtechniken und kurze Pausen nutzen, um Abstand zu schaffen.
- Perspektivenwechsel einüben: fragen „Wird das in einem Jahr noch wichtig sein?“
- Selbstmitgefühl entwickeln: Fehler nicht als Katastrophe, sondern als Lernchance sehen.
Gelassenheit im sozialen Miteinander
Gelassenheit ist auch eine Haltung, die wir im Kontakt mit anderen fördern können:
- Aktiv zuhören, statt vorschnell zu reagieren.
- Konflikte deeskalieren, indem wir Ruhe und Klarheit ausstrahlen.
- Gelassenheit vorleben: das wirkt oft stärker als jede Erklärung.
Mein Fazit: Gelassenheit ist kein Luxus, sondern eine Ressource – gerade in Zeiten hoher Arbeitsbelastung. Sie ermöglicht uns, klar zu handeln, statt impulsiv zu reagieren, und schafft den Raum für Kreativität, Zusammenarbeit und Resilienz.
Welche Strategien helfen dir, Gelassenheit in hektischen Momenten zu bewahren? Teile gerne deine Erfahrungen!
Quellen Davidson, R. J., Kabat-Zinn, J., Schumacher, J., Rosenkranz, M., Muller, D., Santorelli, S. F., Urbanowski, F., Harrington, A., Bonus, K., & Sheridan, J. F. (2003). Alterations in brain and immune function produced by mindfulness meditation. Psychosomatic Medicine, 65(4), 564–570. https://doi.org/10.1097/01.PSY.0000077505.67574.E3